Geschenke sind eine gängige Form der Vermögensübertragung im Alltag, sei es aus familiären Gründen oder aus reiner Freundschaft. Nach deutschem Recht sind Geschenke in § 516 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) als unentgeltliche Übertragungen definiert, bei denen der Schenkende einen Vermögenswert aus seinem Vermögen an den Empfänger überträgt, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten.
Ein Schenkungsvertrag dient als rechtliche Grundlage und Absicherung für beide Parteien, hilft Streitigkeiten zu vermeiden und schafft Transparenz.
Um eine Spende rechtskonform und ordnungsgemäß abzuwickeln, ist es unerlässlich, die geltenden Gesetze, Vorschriften und Gerichtsurteile zu kennen und zu beachten.
Neu: Erstellen Sie mit unserem Tool ganz einfach eine individuelle Schenkungsvereinbarung: Sie finden es unter diesem Link
Der folgende Artikel bietet einen detaillierten und fundierten Einblick in das Thema Schenkungsverträge und erläutert, wann diese erforderlich sind und warum. In diesem Zusammenhang wird auch auf den Dokumentengenerator von Beglaubigt.de verwiesen, der schnell rechtskonforme Verträge als PDF- oder Word-Dokumente erstellt.
Ein Schenkungsvertrag kann beispielsweise in folgenden Situationen erforderlich sein:
- Schenkung von Immobilien oder Grundstücken
- Wertvolle Kunstgegenstände oder Antiquitäten
- Geschenkvertrag für ein Pferd
- Geschenkvertrag für ein Auto
- Übertragung von Unternehmensanteilen
Im Jahr 2023 wurden in Deutschland steuerrelevante Schenkungen in Höhe von insgesamt 60,3 Milliarden Euro verzeichnet – ein Anstieg von 44,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die daraus resultierende Schenkungssteuer belief sich auf 4,1 Milliarden Euro (ein Anstieg von 24,9 %). Besonders stark nahmen große Unternehmensübertragungen über 26 Millionen Euro zu, die sich auf 15,7 Milliarden Euro mehr als vervierfachten. Diese Zahlen verdeutlichen die wachsende Bedeutung von Schenkungen als Mittel der Vermögensübertragung in Deutschland.
Aktuelle Gesetze, Paragraphen und Gerichtsurteile werden zitiert, um bestmögliche Informationen zu liefern und einen fundierten Einblick in das Thema zu ermöglichen. So wird beispielsweise auf die §§ 516–534 BGB verwiesen, die die Rechtsgrundlage für Schenkungen und Schenkungsverträge darstellen.
Durch eine objektive, detaillierte und gründliche Analyse des Themas sollte eine fundierte Entscheidung über die Notwendigkeit einer Schenkungsvereinbarung getroffen und mögliche rechtliche Fallstricke vermieden werden.
Eine ausführliche Erklärung, was genau eine Schenkungsvereinbarung ist und was sie enthalten sollte, finden Sie im Artikel Was ist eine Schenkungsvereinbarung?
Warum ein Schenkungsvertrag?
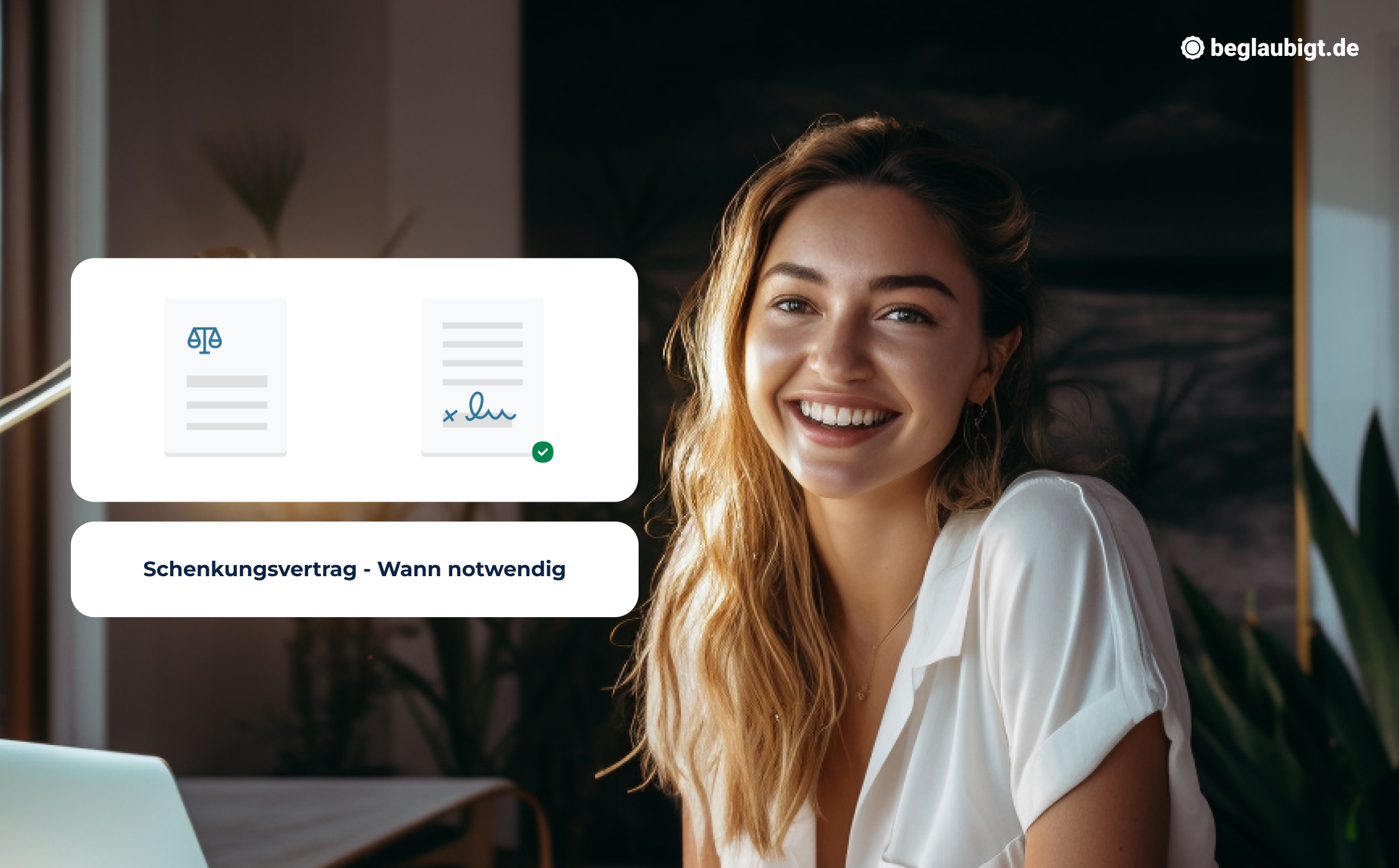
Ein Schenkungsvertrag ist aus verschiedenen Gründen wichtig und nützlich:
- Rechtssicherheit: Eine dokumentierte Schenkungsvereinbarung garantiert Klarheit und Rechtssicherheit. Durch die genaue Festlegung der Bedingungen und des Umfangs der Schenkung können spätere Konflikte oder Missverständnisse vermieden werden.
- Gestaltungsfreiheit: Der Schenkungsvertrag ermöglicht es dem Schenkenden, individuelle Bedingungen festzulegen, wie beispielsweise besondere Anforderungen oder Rückforderungsrechte. Dies gibt dem Schenkenden Flexibilität und Kontrolle über die Gestaltung der Schenkung.
- Steuervorteile: Eine Schenkungsvereinbarung kann Steuervorteile bieten, insbesondere im Bereich der Erbschaftssteuer. Durch frühzeitige Vermögensübertragungen können Sie Steuerfreibeträge nutzen und Ihre Steuerlast minimieren. Die Vereinbarung dient auch als Nachweis für das Finanzamt. Die Steuerfreibeträge für Schenkungen wurden zuletzt im Jahr 2025 angepasst. Ehepartner und eingetragene Lebenspartner können bis zu 500.000 € steuerfrei verschenken, Kinder bis zu 400.000 € und Enkelkinder bis zu 200.000 €. Für Geschwister, Nichten, Neffen und Freunde beträgt der Freibetrag 20.000 €. Diese Freibeträge können alle zehn Jahre erneut in Anspruch genommen werden. Wer seine Schenkungen langfristig plant, kann so große Vermögenswerte nahezu steuerfrei übertragen.
- Frühzeitige Vermögensübertragung: Eine Schenkungsvereinbarung ermöglicht die gezielte Übertragung von Vermögenswerten zu Lebzeiten des Schenkers. Dies erleichtert die frühzeitige Regelung des Nachlasses und kann Erbschaftsstreitigkeiten minimieren.
- Gesetzliche Anforderungen: Für die Übertragung bestimmter Vermögenswerte, wie beispielsweise Immobilien, ist eine Schenkungsvereinbarung gesetzlich vorgeschrieben, die häufig eine notarielle Beglaubigung erfordert, damit die Schenkung rechtsgültig ist.
Studien zeigen auch, dass 50 % aller Schenkungen an die reichsten 10 % der Empfänger gehen, was erheblich zur wachsenden Vermögensungleichheit beiträgt (Quelle: FinanzNachrichten.de). Dies unterstreicht die Bedeutung transparenter Vorschriften und individueller Vertragsgestaltung, um einen gerechteren Vermögensübergang zu gewährleisten.
Insgesamt bietet ein Schenkungsvertrag sowohl für den Schenkenden als auch für den Beschenkten zahlreiche Vorteile. Er gewährleistet die Rechtssicherheit der Schenkung, ermöglicht eine individuelle Gestaltung und kann unter bestimmten Umständen steuerliche Vorteile bieten. Es wird empfohlen, sich in Schenkungsfragen von einem Experten beraten zu lassen, um mögliche Fehler und Fallstricke zu vermeiden.
Wann ist ein Schenkungsvertrag erforderlich?
Ein Schenkungsvertrag ist erforderlich, wenn Vermögenswerte oder Rechte unentgeltlich von einer Person (dem Schenkenden) auf eine andere Person (den Beschenkten) übertragen werden.
Die Notwendigkeit einer Schenkungsvereinbarung hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art des Vermögensgegenstands und den für die Schenkung geltenden gesetzlichen Bestimmungen. In den folgenden Fällen ist eine Schenkungsvereinbarung erforderlich:
- Immobilienübertragung: Bei der Schenkung von Grundstücken oder Immobilien ist gemäß § 311b Abs. 1 Satz 1 BGB eine notariell beurkundete Schenkungsvereinbarung erforderlich. Dadurch wird sichergestellt, dass die Schenkung rechtswirksam ist und beide Parteien über ihre Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Schenkung informiert sind.
- Wertvolle Vermögenswerte: Bei der Spende wertvoller Vermögenswerte wie Kunstwerke, Antiquitäten oder Schmuck ist es ratsam, einen Spendenvertrag abzuschließen, um Unklarheiten oder Streitigkeiten zu vermeiden. Obwohl für diese Art von Spende keine gesetzlichen Formvorschriften bestehen, kann ein schriftlicher Vertrag beiden Parteien Klarheit und Sicherheit bieten.
- Fahrzeugübertragung: Bei der Spende eines Kraftfahrzeugs ist es ratsam, einen Spendenvertrag abzuschließen, um die Übertragung des Eigentums zu dokumentieren und die Umschreibung bei der Zulassungsbehörde zu erleichtern. Ein schriftlicher Vertrag sollte die Fahrzeugidentifikationsnummer, den Kilometerstand und alle relevanten Informationen über das Fahrzeug enthalten.
- Übertragung von Unternehmensanteilen: Bei der Schenkung von Unternehmensanteilen oder Aktien ist ein Schenkungsvertrag erforderlich, um die Übertragung des Eigentums zu regeln und mögliche steuerliche Konsequenzen zu berücksichtigen. Je nach Rechtsform des Unternehmens können unterschiedliche Anforderungen an den Vertrag gestellt werden.
- Geschenke mit Bedingungen oder Auflagen: In Fällen, in denen der Schenkende bestimmte Bedingungen oder Auflagen an das Geschenk knüpft, sollte eine Schenkungsvereinbarung geschlossen werden, um die Einhaltung dieser Bedingungen oder Auflagen sicherzustellen und die Rechtsposition des Schenkenden zu wahren.
Schenkungsvertrag – wann ist er notwendig und warum? Was sind die Vorteile?
Die Vorteile einer Schenkungsvereinbarung sind vielfältig und umfassen unter anderem:
- Rechtssicherheit: Eine schriftliche Schenkungsvereinbarung bietet sowohl dem Schenkenden als auch dem Beschenkten Rechtssicherheit, indem sie die Bedingungen und den Umfang der Schenkung klar und eindeutig definiert und so künftige Streitigkeiten oder Missverständnisse verhindert.
- Gestaltungsmöglichkeiten: Eine Schenkungsvereinbarung ermöglicht es dem Schenkenden, bestimmte Anforderungen, Bedingungen oder Rückforderungsrechte zu vereinbaren, wodurch die Schenkung individuell gestaltet werden kann und der Schenkende mehr Kontrolle darüber erhält, wie die geschenkten Vermögenswerte verwendet werden.
- Steuervorteile: Eine Schenkung kann Steuervorteile bieten, insbesondere im Hinblick auf die Erbschaftssteuer. Durch eine frühzeitige Übertragung von Vermögenswerten können Sie Steuerfreibeträge in Anspruch nehmen und Steuern sparen. Ein Schenkungsvertrag dokumentiert die Schenkung und unterstützt die Einhaltung der steuerlichen Anforderungen.
- Übertragung von Vermögenswerten zu Lebzeiten: Mit einem Schenkungsvertrag können Sie Vermögenswerte zu Lebzeiten an die nächste Generation oder an Dritte übertragen. Dies hilft Ihnen, Ihren Nachlass frühzeitig zu regeln und mögliche Erbschaftsstreitigkeiten zu vermeiden.
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: In einigen Fällen ist eine Schenkungsvereinbarung gesetzlich vorgeschrieben, beispielsweise bei der Schenkung von Immobilien oder Grundstücken. In solchen Fällen ist eine notarielle Beglaubigung erforderlich, damit die Schenkung rechtsgültig ist.
Geschenkvereinbarung – Bei Bedarf: Eine Fallstudie
Ein Schenkungsvertrag ist notwendig und vorteilhaft, um Rechtssicherheit bei der Übertragung von Vermögenswerten zu gewährleisten und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Ein Beispiel hierfür ist die Schenkung eines Hauses von den Eltern an ihr Kind:
Herr und Frau Müller möchten ihr Haus ihrem Sohn Michael schenken, damit er noch zu Lebzeiten Eigentümer wird und sie von Steuervorteilen profitieren können. Um sicherzustellen, dass die Schenkung rechtsverbindlich ist und sie die Möglichkeit behalten, das Haus unter bestimmten Voraussetzungen zurückzufordern, beschließen die Müllers, einen Schenkungsvertrag aufzusetzen.
Die Schenkungsurkunde legt klar und eindeutig den Umfang der Schenkung und die Bedingungen fest, unter denen das Haus übertragen wird.
Im Vertrag vereinbaren die Müllers beispielsweise ein Rückforderungsrecht für den Fall, dass sie selbst in finanzielle Not geraten oder ihr Sohn ihnen gegenüber grob undankbar wird. Darüber hinaus kann der Vertrag eine Nutzungsbeschränkung enthalten, die vorsieht, dass das Haus nur von Michael und seiner Familie bewohnt werden darf.
Da es sich um eine Schenkung von Immobilien handelt, ist die notarielle Beurkundung des Schenkungsvertrags gesetzlich vorgeschrieben. Nach der notariellen Beurkundung und Eintragung im Grundbuch wird die Schenkung wirksam und Michael ist der neue Eigentümer des Hauses.

Der Schenkungsvertrag bietet Rechtssicherheit für die Übertragung von Vermögenswerten, berücksichtigt individuelle Optionen wie Rückforderungsrechte und Bedingungen und ermöglicht die vollständige Ausschöpfung von Steuervorteilen wie beispielsweise die Nutzung von Freibeträgen.
Wie erfährt das Finanzamt von einer Schenkung?
Das Finanzamt erfährt in der Regel durch die Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten der beteiligten Parteien von einer Schenkung. Gemäß den steuerrechtlichen Vorschriften sind sowohl der Schenkende als auch der Beschenkte verpflichtet, eine Schenkung dem zuständigen Finanzamt zu melden, wenn bestimmte Wertgrenzen überschritten werden.
Hier sind einige Möglichkeiten, wie das Finanzamt von einer Schenkung erfahren kann:
- Selbstanzeige durch die Beteiligten: Der Schenkende und/oder der Beschenkte melden die Schenkung innerhalb der vorgeschriebenen Frist beim Finanzamt. In der Regel müssen die entsprechenden Formulare ausgefüllt und eingereicht werden, um alle relevanten Informationen über die Schenkung anzugeben.
- Beglaubigung: Bei beglaubigten Schenkungen, wie beispielsweise der Übertragung von Immobilien, informiert der Notar in der Regel automatisch das Finanzamt über die Schenkung. Die beteiligten Parteien sollten jedoch sicherstellen, dass sie ihren eigenen Meldepflichten nachkommen.
- Einträge im Grundbuch: Wenn Grundstücke oder Immobilien verschenkt werden, werden sie in der Regel im Grundbuch übertragen. Da das Grundbuch öffentlich zugänglich ist, kann auch das Finanzamt auf diese Weise von der Schenkung erfahren.
- Informationen von Dritten: In einigen Fällen kann das Finanzamt auch durch Informationen von Dritten, wie Banken oder Versicherungsgesellschaften, über eine Schenkung informiert werden.
Es ist unerlässlich, die gesetzlichen Meldepflichten für Geschenke einzuhalten und das Geschenk rechtzeitig beim Finanzamt zu melden. Andernfalls drohen Ihnen zusätzliche Steuerzahlungen, Verzugszinsen oder sogar Geldstrafen.
Neu: Erstellen Sie mit unserem Tool ganz einfach eine individuelle Schenkungsvereinbarung: https://beglaubigt.de/schenkungsvertrag
Ist ein Geschenk ohne Vertrag gültig?
Grundsätzlich ist eine Schenkung auch ohne schriftlichen Vertrag gültig, sofern keine besonderen rechtlichen Formalitäten zu beachten sind. Das bedeutet, dass mündliche Schenkungen oder Schenkungen durch bloße Übergabe – wie beispielsweise Möbel oder Bargeld – rechtlich zulässig sind, wenn die Übergabe tatsächlich stattfindet.
Aber Vorsicht: Bei Immobilien, Unternehmensanteilen, Grundstücken oder größeren Vermögenswerten gelten strenge Formvorschriften. Beispielsweise schreibt § 311b des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) für Schenkungen von Immobilien eine notarielle Beurkundung vor. Ohne diese ist der Vertrag nichtig.

Auch bei der Spende eines Fahrzeugs ist es ratsam, zumindest einen schriftlichen Spendenvertrag aufzusetzen, obwohl eine notarielle Beglaubigung gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. In der Praxis erfordern die Umschreibung beim Kraftfahrzeugamt und der Nachweis der Eigentumsübertragung oft eine eindeutige Dokumentation.
Fazit: Eine Schenkung ohne Vertrag ist nur dann rechtsverbindlich, wenn keine besonderen Formvorschriften bestehen. Dennoch wird eine schriftliche Schenkungsvereinbarung dringend empfohlen, insbesondere bei wertvollen oder komplexen Schenkungen. Sie schützt beide Parteien, dokumentiert die getroffene Vereinbarung und beugt späteren Streitigkeiten vor.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in einem ausführlicheren Artikel: Wann ist eine Schenkungsvereinbarung gültig?
Ist es möglich, eine Schenkung ohne Notar zu machen?
In vielen Fällen ist es möglich, eine Schenkung ohne Notar vorzunehmen, da für die meisten Schenkungen keine gesetzlichen Formvorschriften bestehen. Es gibt jedoch bestimmte Situationen, in denen eine notarielle Beglaubigung erforderlich ist, damit die Schenkung rechtsgültig ist. Die Unterschiede zwischen Schenkungen, die ohne Notar vorgenommen werden können, und solchen, die einer notariellen Beglaubigung bedürfen, werden im Folgenden erläutert.

Die Beglaubigung kann auch für die Übertragung von Unternehmensanteilen oder Aktien erforderlich sein. Dies hängt von der Rechtsform des Unternehmens und den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen ab.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in vielen Fällen möglich ist, eine Schenkung ohne Notar vorzunehmen. Es ist jedoch wichtig, die gesetzlichen Anforderungen und die Art des Vermögens zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Schenkung rechtsgültig ist. In Fällen, in denen eine notarielle Beglaubigung erforderlich ist, sollte darauf geachtet werden, die formalen Anforderungen zu erfüllen, um die Gültigkeit der Schenkung zu gewährleisten.
Wie erfährt das Finanzamt von einer Schenkung?
Das Finanzamt kann auf verschiedene Weise von einer Schenkung erfahren. Hier sind einige der häufigsten Wege, auf denen das Finanzamt über Schenkungen informiert wird:
- Meldepflicht des Beschenkten (30 ErbStG): Der Beschenkte ist gesetzlich verpflichtet, jede Schenkung innerhalb von drei Monaten nach Kenntnisnahme der Schenkung beim zuständigen Finanzamt zu melden, unabhängig vom Wert der Schenkung. Dies gilt auch dann, wenn keine Schenkungssteuer zu entrichten ist, da die Freibeträge (z. B. 500.000 € für Ehepartner, 400.000 € für Kinder) alle zehn Jahre erneut in Anspruch genommen werden können. In der Regel reicht eine formlose Mitteilung mit Angaben zu Schenkendem, Beschenktem, Wert und Datum der Schenkung aus. Die Nichteinhaltung dieser Pflichten kann zu Geldbußen und Nachzahlungen führen.
- Notar: Bei Schenkungen, die einer notariellen Beurkundung bedürfen, wie beispielsweise Schenkungen von Immobilien, ist der Notar verpflichtet, die Schenkung dem Finanzamt zu melden. Dies geschieht in der Regel dadurch, dass der Notar eine Kopie des Schenkungsvertrags an das zuständige Finanzamt übermittelt.
- Banken und andere Finanzinstitute: Wenn Bankguthaben, Wertpapiere oder Aktien verschenkt werden, kann das Finanzamt von den beteiligten Banken oder Finanzinstituten informiert werden. In vielen Fällen sind diese Institute gesetzlich verpflichtet, bestimmte Transaktionen den Steuerbehörden zu melden.
- Behörden und Ämter: Bei Schenkungen, die eine Änderung der Eintragung oder eine Änderung im Grundbuch erfordern, wie beispielsweise Schenkungen von Immobilien oder Fahrzeugen, können die zuständigen Behörden und Ämter das Finanzamt über die Schenkung informieren.
- Selbstanzeige durch den Schenkenden: Der Schenkende kann die Schenkung auch freiwillig beim Finanzamt melden, insbesondere wenn er der Meinung ist, dass die Schenkung steuerliche Auswirkungen haben könnte. Dies kann dazu beitragen, spätere Unklarheiten oder mögliche zusätzliche Steuerforderungen zu vermeiden.
Wichtige Informationen für 2025:
- Jedes Geschenk muss gemeldet werden, auch wenn sein Wert unterhalb der Freigrenze liegt.
- Zuständig ist das Finanzamt am Wohnort des Spenders, nicht unbedingt das Finanzamt am Wohnort des Empfängers.
- Die Mitteilung löst die Verjährungsfrist für die Schenkungssteuer aus (in der Regel 4 Jahre).
- Wer seinen Verpflichtungen nachkommt, vermeidet Steuerstrafen und kann Steuerfreibeträge optimal nutzen.
Unter welchen Umständen gilt eine Zuwendung nicht als Schenkung?
Ein Geschenk ist definiert als die unentgeltliche Übertragung eines Vermögenswerts oder Rechts von einer Person (dem Schenker) auf eine andere (den Beschenkten) mit der Absicht der Bereicherung. Es gibt jedoch Situationen, in denen ein vermeintliches Geschenk rechtlich nicht als solches eingestuft wird:
- Verträge gegen Entgelt: Wenn der Empfänger für den erhaltenen Vermögenswert oder das erhaltene Recht eine Gegenleistung erbringt, handelt es sich nicht um eine Schenkung, sondern um einen Vertrag gegen Entgelt, beispielsweise einen Kauf- oder Tauschvertrag.
- Erwartung einer Schenkung: Eine Zusage, eine Schenkung zu machen, stellt eine verbindliche Verpflichtung dar, in Zukunft eine Schenkung zu tätigen. Diese Zusage allein führt jedoch noch nicht zu einer Schenkung; es bedarf einer weiteren Willenserklärung des Schenkers, damit die Schenkung rechtswirksam wird.
- Darlehensverträge: Bei einem Darlehen wird ein Vermögenswert oder ein Recht nur zur vorübergehenden Nutzung übertragen. Da es sich nicht um eine dauerhafte Übertragung handelt und der Gegenstand oder das Recht zurückgegeben werden muss, handelt es sich nicht um eine Schenkung.
- Übernahme von Kosten aus moralischer Verpflichtung: Wenn jemand freiwillig aus moralischer Verpflichtung oder aus Gründen der Nächstenliebe Kosten für eine andere Person übernimmt, beispielsweise die Finanzierung einer Beerdigung, gilt dies rechtlich nicht als Schenkung, da keine Absicht besteht, sich selbst zu bereichern.
- Nichtige Schenkungen: Unter bestimmten Umständen kann eine Schenkung nichtig sein, beispielsweise bei Formfehlern (z. B. fehlende notarielle Beglaubigung bei Immobilienübertragungen) oder Anfechtung (z. B. aufgrund von Betrug oder Irrtum). In solchen Fällen wird die Schenkung rechtlich nicht anerkannt.
Das Verständnis der Unterschiede zwischen einer Schenkung und anderen Rechtsverhältnissen ist wichtig, um die jeweiligen rechtlichen Konsequenzen und Verpflichtungen zu verstehen.
Was sind einige häufige Fehler und Fallstricke bei Schenkungsverträgen?
Bei Schenkungsverträgen können verschiedene Fehler und Fallstricke auftreten, die zu rechtlichen und steuerlichen Problemen führen können. Hier sind einige häufige Fehler und Fallstricke:
- Unzureichende oder falsche Vertragsangaben: Ein Schenkungsvertrag sollte alle relevanten Informationen und Bedingungen enthalten, um Rechtssicherheit zu gewährleisten. Unklare oder fehlende Angaben können zu Missverständnissen und Streitigkeiten führen. Es ist daher wichtig, den Vertrag sorgfältig und vollständig zu formulieren.
- Nicht notarielle Beglaubigung des Vertrags: In bestimmten Fällen, wie beispielsweise bei der Übertragung von Immobilien oder Grundstücken, ist die notarielle Beglaubigung des Schenkungsvertrags gesetzlich vorgeschrieben. Wird ein solcher Vertrag nicht notariell beglaubigt, kann dies zur Ungültigkeit der Schenkung führen.
- Nichteinhaltung von Fristen und Formalitäten: Schenkungen unterliegen häufig bestimmten Fristen und Formalitäten, beispielsweise in Bezug auf steuerliche Meldepflichten oder die Eintragung im Grundbuch. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen kann zu rechtlichen Problemen und möglicherweise finanziellen Nachteilen führen.
- Nichtmeldung für Steuerzwecke: Geschenke müssen möglicherweise beim Finanzamt gemeldet werden, insbesondere wenn bestimmte Wertgrenzen überschritten werden. Die Nichteinhaltung dieser Meldepflicht kann zu zusätzlichen Steuerzahlungen und Strafen führen.
- Missverständnisse über Rückforderungsrechte: Bei einer Schenkung kann der Schenkende unter bestimmten Bedingungen Rückforderungsrechte vereinbaren. Sind diese Rechte jedoch nicht korrekt im Schenkungsvertrag verankert, können sie ungültig sein oder zu Streitigkeiten führen.
- Mangelnde Kenntnisse über Steuerfreibeträge und Vorschriften: Die Schenkungssteuer unterliegt verschiedenen Freibeträgen und Vorschriften, die sich nach dem Verwandtschaftsgrad der beteiligten Parteien und dem Wert der Schenkung richten. Unzureichende Kenntnisse dieser Vorschriften können zu einer ungünstigen steuerlichen Behandlung der Schenkung führen.
Der Artikel Wie verfasst man einen Schenkungsvertrag? enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfassen eines Schenkungsvertrags.
Welche gesetzlichen Anforderungen müssen beachtet werden?
Rechtsgrundlage für Geschenke in Deutschland
Eine Schenkung ist eine freiwillige, unentgeltliche Übertragung von Vermögenswerten von einer Person (dem Schenkenden) auf eine andere Person (den Beschenkten). In Deutschland sind dabei sowohl zivilrechtliche als auch steuerrechtliche Vorschriften zu beachten.
1. Zivilrechtliche Vorschriften: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) definiert eine Schenkung in § 516 als einen Vertrag, durch den eine Person eine andere Person aus ihrem eigenen Vermögen bereichert und beide Parteien vereinbaren, dass die Schenkung unentgeltlich erfolgt.
Einige wichtige Bestimmungen im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zu Schenkungen sind:
- Form der Schenkung (§ 518 BGB): Grundsätzlich kann eine Schenkung ohne besondere Formvorschriften erfolgen. Bestimmte Schenkungen, wie beispielsweise Immobilien, bedürfen jedoch der notariellen Beurkundung.
- Widerruf einer Schenkung (§ 530 BGB): Unter bestimmten Umständen kann der Schenkende die Schenkung widerrufen, z. B. wenn er aufgrund eines schwerwiegenden Fehlverhaltens des Beschenkten Grund zur Beschwerde hat.
- Pflichtteil und Schenkungen (§ 2325 BGB): Stirbt der Schenkende innerhalb von 10 Jahren nach der Schenkung, kann die Schenkung bei der Berechnung des Pflichtteils des Erben berücksichtigt werden.
- Unmöglichkeit der Leistung und Schenkungsversprechen (§§ 523, 524 BGB): Ist die versprochene Schenkung nicht mehr möglich oder wird das Schenkungsversprechen nicht erfüllt, gibt es Bestimmungen für Rückforderung oder Schadensersatzansprüche.
2. Steuerrechtliche Vorschriften: Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz (ErbStG)
Bei der Übertragung von Vermögenswerten kann Schenkungssteuer anfallen. Das deutsche Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) regelt die Besteuerung von Erwerbungen durch Schenkungen oder Erbschaften.
Einige wichtige Aspekte des ErbStG:
- Ausnahmen: Es gibt bestimmte Ausnahmen, bis zu denen keine Schenkungssteuer zu entrichten ist. Diese variieren je nach Verwandtschaftsgrad zwischen Schenkendem und Beschenktem. Beispielsweise gilt für Ehepartner und eingetragene Lebenspartner ein Freibetrag von 500.000 Dollar, für Kinder 400.000 Dollar und für Enkelkinder 200.000 Dollar.
- Steuerklassen: Je nach Verwandtschaftsgrad gelten unterschiedliche Steuersätze.
- Ausnahmeregelungen: Für bestimmte Arten von Vermögenswerten, wie z. B. Betriebsvermögen, können Ausnahmeregelungen gelten, die die Steuerlast verringern können.
- Zehnjahresregel: Wenn zwischen zwei Schenkungen an denselben Empfänger weniger als zehn Jahre liegen, werden diese Schenkungen zusammengerechnet und können sich auf die Steuerfreibeträge auswirken.
Was ist besser: Übertragung oder Schenkung?
Ob eine Übertragung oder eine Schenkung die bessere Wahl ist, hängt von Ihren individuellen Zielen, der Art der Vermögenswerte und den steuerlichen Rahmenbedingungen ab. Beide Optionen haben spezifische Vor- und Nachteile, die Sie bei der Planung Ihrer Vermögensübertragung unbedingt berücksichtigen sollten:
- Steuerliche Aspekte: Wenn Sie jemandem etwas schenken, müssen Sie möglicherweise Schenkungssteuer und unter Umständen sogar Grunderwerbsteuer zahlen. Es gibt jedoch einige Steuervergünstigungen, die sich je nach Ihrer Beziehung zu der Person ändern und alle zehn Jahre erneut in Anspruch genommen werden können. Bei einer entgeltlichen Übertragung, beispielsweise im Rahmen eines Kaufvertrags, ist Grunderwerbsteuer zu entrichten und in einigen Fällen auch Einkommensteuer auf den erzielten Gewinn. Es ist wichtig, die steuerlichen Auswirkungen beider Optionen sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls einen Steuerberater zu konsultieren.
- Verfügungsbeschränkungen: Bei einer Schenkung kann der Schenkende in der Schenkungsvereinbarung Verfügungsbeschränkungen oder Rückforderungsrechte vereinbaren, um den Vermögenswert bei Bedarf zurückzufordern, beispielsweise bei einer erheblichen Verschlechterung der finanziellen Verhältnisse des Schenkenden. Bei einer entgeltlichen Übertragung sind solche Verfügungsbeschränkungen in der Regel nicht möglich.
- Ansprüche auf Ergänzung der Pflichtteilsquote: Bei einer Schenkung können Ansprüche auf Ergänzung der Pflichtteilsquote entstehen, wenn der Schenkende verstirbt und die Schenkung innerhalb der letzten zehn Jahre vor seinem Tod erfolgt ist. In diesem Fall müssen die Pflichtteilsberechtigten berücksichtigt werden, und es kann ein Rückforderungsanspruch oder eine Zahlungsverpflichtung entstehen. Bei einer entgeltlichen Übertragung sind Ansprüche auf Ergänzung der Pflichtteilsquote in der Regel ausgeschlossen.
- Vorbehaltene Nutzungsrechte: Im Falle einer Schenkung kann der Schenkende in der Schenkungsvereinbarung ein lebenslanges Wohnrecht oder ein Nießbrauchsrecht vereinbaren, um sich die Nutzung des übertragenen Vermögensgegenstands zu sichern. Bei einer entgeltlichen Übertragung ist dies in der Regel nicht möglich.
Für eine steueroptimierte und flexible Vermögensübertragung ist eine Schenkung in der Regel die bessere Option – insbesondere bei Immobilien und Familienvermögen. Die Übertragung des Eigentums gegen Zahlung kann sinnvoll sein, wenn eine klare Kaufabsicht besteht oder wenn keine Veräußerungsbeschränkungen gewünscht sind.
Eine individuelle Beratung durch Steuerexperten und Notare ist unerlässlich, um die optimale Lösung für Ihre persönliche Situation zu finden und steuerliche Nachteile zu vermeiden.
Fazit: Wann ist ein Schenkungsvertrag notwendig – und warum lohnt er sich?
Ein Schenkungsvertrag ist immer erforderlich, wenn rechtliche oder steuerliche Risiken ausgeschlossen werden sollen – insbesondere bei Immobilienschenkungen, Unternehmensanteilen oder Schenkungen mit Auflagen. In solchen Fällen verlangt das Gesetz häufig eine notarielle Beurkundung (§ 311b BGB).
Obwohl einfache Geschenke – wie Geldbeträge oder bewegliche Gegenstände – auch ohne Vertrag gültig sind, besteht oft Rechtsunsicherheit. Ohne schriftliche Vereinbarung besteht die Gefahr von Missverständnissen, fehlenden Nachweisen für das Finanzamt oder sogar Rechtsstreitigkeiten.
Darüber hinaus unterliegen Geschenke der Steuerpflicht, sobald der Freibetrag überschritten wird. Das Finanzamt erfährt beispielsweise durch den Notar, das Grundbuchamt oder durch Meldungen von Banken von dem Geschenk.
Eine schriftliche Schenkungsvereinbarung sorgt für Klarheit:
- ✅ Überprüfbarkeit gegenüber dem Finanzamt
- ✅ Rechtssicherheit für hohe Werte oder Anforderungen
- ✅ Kreative Freiheit durch Rückforderungsrechte oder Nutzungsrechte
- ✅ Optimale steuerliche Nutzung von Freibeträgen
Hinweis: Wenn keine Gegenleistung und kein Darlehen vorliegen und alle formalen Anforderungen erfüllt sind, ist die Schenkung echt und rechtsgültig.






